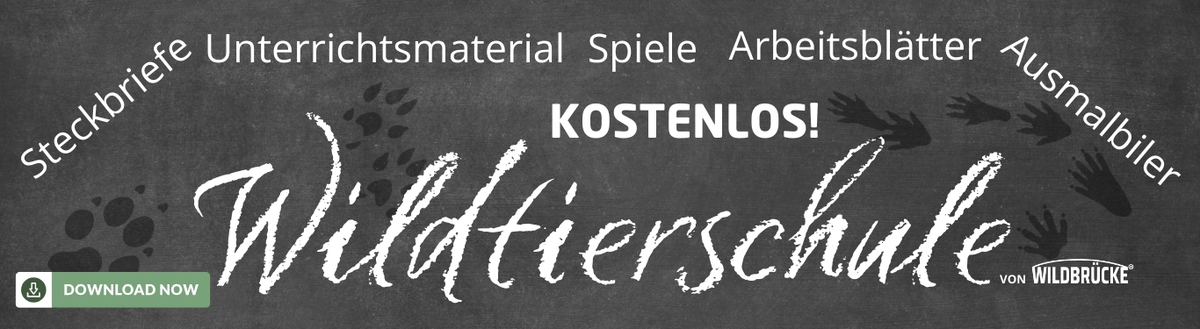Foto: iStock/GlobalP
Name:
Alpenmurmeltier (Murmeltier)
Wissenschaftlicher Name:
Marmota marmota
Klasse:
Säugetiere
Ordnung:
Nagetiere
Familie:
Hörnchen
Aussehen

Größe:
Kopf-Rumpf-Länge etwa 42 bis 54 cm, Schwanzlänge ca. 13 bis 16 cm

Gewicht:
Zwischen 3 und 7 Kilogramm, im Herbst vor dem Winterschlaf schwerer

Alter:
In freier Wildbahn bis zu 15 Jahre, in Gefangenschaft bis zu 18 Jahre
Nahrung
Gräser, Kräuter, Blätter und Wurzeln. Sie ernähren sich hauptsächlich
von der Vegetation der Hochgebirgswiesen
Verbreitung
Alpenregionen in Europa, vor allem in den Alpen, Pyrenäen und
einigen anderen Hochgebirgsregionen
Spuren

Heimsich oder Invasiv
Hochalpine Zonen Europas, in Österreich, der Schweiz, Frankreich,
Italien und Deutschland
Lebensweise
Winterschlaf von etwa 6 bis 8 Monaten
Lebensraum
Hochgebirge auf 800 bis 3.200 Metern Höhe
Feinde
Greifvögel, wie Steinadler, sowie Füchse und Luchse
Gefährdet?
Das Murmeltier gilt als ungefährdet.
Einstufung in die Rote-Liste-Kategorien

Ausgestorben oder verschollen

Vom Aussterben bedroht

Stark gefährdet

Gefährdet

Gefährdung unbekannten
Ausmaßes

Extrem selten

Vorwarnliste

Ungefährdet

Ungefährdet
Quelle: www.rote-liste-zentrum.de
Interessante Fakten
-
Winterschlaf-Experten: Murmeltiere halten einen der längsten Winterschläfe im Tierreich. Sie schlafen bis zu 7 Monate, um den kalten Winter zu überstehen, und senken dabei ihre Körpertemperatur stark ab.
-
Soziale Tiere: Murmeltiere leben in Familiengruppen und sind sehr sozial. Sie kommunizieren untereinander durch verschiedene Laute und verbringen Zeit miteinander beim Sonnenbaden oder Spielen.
-
Lautstarke Warnsysteme: Bei Gefahr pfeifen Murmeltiere laut, um ihre Familienmitglieder zu warnen. Diese Warnrufe sind so effektiv, dass sie oft auch von anderen Tieren als Gefahrensignal erkannt werden.
-
Geschickte Baumeister: Murmeltiere graben komplexe Höhlensysteme mit mehreren Kammern und Notausgängen. Diese Höhlen schützen sie vor Raubtieren und bieten ihnen einen sicheren Ort für ihren Winterschlaf.
-
Größte Nagetiere in den Bergen: In den Alpen und anderen Bergregionen sind Murmeltiere die größten Nagetiere. Sie können bis zu 8 Kilogramm wiegen und eine Länge von bis zu 60 cm erreichen.
-
Pflanzenfresser: Murmeltiere sind reine Pflanzenfresser und ernähren sich von Gräsern, Kräutern und Blättern. Sie fressen sich im Sommer eine dicke Fettschicht an, die sie durch den langen Winter bringt.
-
Familienbindung: Jungtiere bleiben in der Regel bis zu zwei Jahre bei ihrer Familie, bevor sie eigene Höhlen graben. Die enge Bindung zur Familie ist wichtig für ihr Überleben.
-
Gut an das Leben in Höhenlagen angepasst: Murmeltiere leben oft in Bergregionen und haben eine robuste Anpassung an das raue Klima und die dünnere Luft in hohen Lagen.
-
Sehr gute Augen und Ohren: Murmeltiere haben ein ausgezeichnetes Seh- und Hörvermögen, was ihnen hilft, Feinde frühzeitig zu erkennen.
-
Lebensdauer: In freier Wildbahn können Murmeltiere etwa 6 bis 15 Jahre alt werden. In sicheren Umgebungen wie in Zoos erreichen sie häufig sogar ein höheres Alter.
Häufig gestellte Fragen
Warum heißt das Murmeltier "Murmeltier"?
Das Murmeltier heißt „Murmeltier“, weil es bei Gefahr ein charakteristisches Murmeln oder Pfeifen von sich gibt. Dieser Laut dient als Warnsignal für die anderen Murmeltiere in der Gruppe, damit sie rechtzeitig in ihren Bauten Schutz suchen können.
Welche Geräusche macht ein Murmeltier?
Ein Murmeltier gibt bei Gefahr ein lautes, pfeifendes Geräusch von sich, das wie ein schriller Pfiff klingt. Dieses Pfeifen dient als Warnruf, um die anderen Tiere in der Nähe vor Feinden zu warnen.
Was bedeutet die Redewendung „schlafen wie ein Murmeltier“?
Die Redewendung „schlafen wie ein Murmeltier“ bezieht sich auf den tiefen, langen Winterschlaf, den Murmeltiere halten. Während des Winters schlafen Murmeltiere mehrere Monate am Stück in ihren geschützten Bauten und reduzieren dabei ihre Körperfunktionen auf ein Minimum. Diese Fähigkeit zu tiefem und ungestörtem Schlaf hat der Redewendung ihren Ursprung gegeben und bedeutet, sehr fest und erholsam zu schlafen.
Was heißt Murmeltier auf Englisch?
Murmeltier heißt auf Englisch marmot.
Was macht das Murmeltier im Winter?
Im Winter hält das Murmeltier einen langen Winterschlaf, der etwa sechs bis sieben Monate dauert. Während dieser Zeit bleibt es in seinem geschützten Bau und senkt seine Körpertemperatur sowie seinen Herzschlag, um Energie zu sparen. Das Murmeltier lebt im Winter ausschließlich von den Fettreserven, die es sich im Sommer und Herbst angefressen hat, und verlässt seinen Bau in dieser Zeit überhaupt nicht.
Wo finde ich einen Steckbrief über das Murmeltier?
Einen ausführlichen Steckbrief über das Murmeltier kannst du dir kostenlos auf unserer Website herunterladen. Dort erfährst du alles über Lebensweise, Nahrung, Winterschlaf und Lebensraum dieses faszinierenden Nagetiers.
Videos
Downloadbereich
Murmeltier Steckbrief
Sichere dir den kostenlosen Steckbrief zum Murmeltier – und über 100 weitere spannende Wildtier-PDFs für Unterricht, Naturpädagogik oder zuhause. Einfach E-Mail eintragen und los geht’s!
Interessante und spannende Artikel
Waldkauz Ruf
Waldkauz Ruf ist besonders in den Abendstunden zu hören und gilt als typisches Merkmal für diese nachtaktive Eulenart in Deutschland.
Nilgans in Deutschland
Nilgans in Deutschland ist heute ein fester Bestandteil der heimischen Vogelwelt und sorgt in Städten und an Gewässern für Aufmerksamkeit.
Unterschied Kanadagans und Nilgans
Unterschied Kanadagans und Nilgans zeigt sich in Gefieder, Größe, Lautäußerungen und Sozialverhalten, was eine klare Unterscheidung in der Natur ermöglicht.
Nilgans Küken
Nilgans Küken sind flauschige, bewegliche Jungvögel, die schon kurz nach der Geburt mit ihren Eltern auf Wanderschaft gehen.
Grünfink Jungvogel
Grünfink Jungvogel zeigt trotz seiner zurückhaltenden Erscheinung ein eigenständiges Verhalten und wächst schnell zu einem kräftigen Finken heran.
Grünfink Weibchen
Grünfink Weibchen ist dezenter gefärbt als das Männchen, doch ebenso anpassungsfähig, wachsam und unverzichtbar für die Aufzucht der Jungen.
Grünfink Gesang
Grünfink Gesang ist kraftvoll, rau und gut wiederzuerkennen – ein akustisches Markenzeichen der grünen Finken.
Gimpel Jungvogel
Gimpel Jungvogel zeigt bereits kurz nach dem Schlüpfen das typische Verhalten der Art und wird durch seine Entwicklung rasch erkennbar.
Gimpel Gesang
Gimpel Gesang klingt zart und melancholisch und unterscheidet sich deutlich von vielen anderen lauten Vogelstimmen.
Gimpel Weibchen
Gimpel Weibchen ist unauffälliger gefärbt als das Männchen, lässt sich aber mit geübtem Blick gut bestimmen.