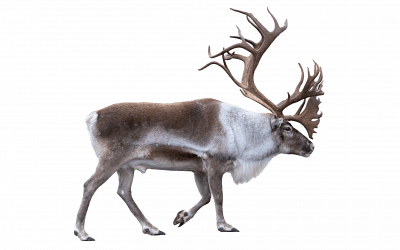Symbolfoto Schneeleopard: iStock/Rixipix
Der Schneeleopard zählt zu den geheimnisvollsten Wildtieren der Erde – selten gesehen, kaum fotografiert und schwer zu erforschen. Nun ist es Forschern in Bhutan gelungen, den scheuen Schneeleoparden (Panthera uncia) auf ganz neue Weise nachzuweisen. Wie der World Wildlife Fund (WWF) berichtet, wurden in mehreren Flussgebieten des Himalaya genetische Spuren der Großkatze entdeckt – mithilfe sogenannter Umwelt-DNA, kurz eDNA. Diese moderne Methode erlaubt es, Tierarten über ihre genetischen Rückstände im Wasser oder Boden zu identifizieren, ohne sie direkt beobachten zu müssen.
Das Forschungsteam des WWF sammelte Wasserproben in zentralen und westlichen Regionen Bhutans, um Hinweise auf die dort lebenden Tierarten zu gewinnen. In diesen Proben fanden Wissenschaftler schließlich DNA-Spuren, die eindeutig dem Schneeleoparden zugeordnet werden konnten. Nach Angaben des WWF handelt es sich dabei um den ersten offiziellen eDNA-Nachweis dieser Art im Land.
Die Entdeckung zeigt, dass Schneeleoparden nicht nur in den extremen Höhen der Himalaya-Gebirgsketten leben, sondern auch in tiefer gelegenen Regionen vorkommen. Diese Erkenntnis erweitert das bisherige Verständnis ihres Lebensraums erheblich. Zudem ermöglicht die eDNA-Methode eine schonende Erfassung gefährdeter Wildtiere, da keine Fallen, Kameras oder Sender notwendig sind.
Bedeutung für den Schutz des Schneeleoparden
Wie der WWF betont, ist der Nachweis von enormer Bedeutung für den internationalen Artenschutz. Weltweit leben Schätzungen zufolge weniger als 7.000 Schneeleoparden, und ihr Bestand nimmt weiter ab. Hauptbedrohungen sind Wilderei, Lebensraumverlust und Konflikte mit Viehhaltern.
Der Fund in Bhutan gilt daher als Hoffnungssignal: Die gesammelten Daten fließen direkt in das Nationale Schneeleoparden-Monitoring-Programm des Landes ein, das von der bhutanischen Regierung in Kooperation mit dem WWF betrieben wird. Ziel ist es, die Verbreitung der Tiere besser zu dokumentieren und effektive Schutzstrategien zu entwickeln.
Internationale Zusammenarbeit als Schlüssel
Symbolfoto Schneeleopard Jungtier: iStock/gnagel
Bhutan als Vorreiter beim Einsatz von Umwelt-DNA
Der erfolgreiche Nachweis zeigt, wie stark sich der Einsatz moderner Methoden im Naturschutz verändert. Nach Angaben des WWF wird die Umwelt-DNA-Analyse künftig eine noch größere Rolle beim Monitoring bedrohter Arten spielen. Besonders in schwer zugänglichen Gebirgsregionen wie dem Himalaya bietet sie enorme Vorteile.
Bhutan zählt bereits heute zu den Ländern Asiens, die am konsequentesten den Schutz ihrer Bergökosysteme verfolgen. Über 50 Prozent der Landesfläche stehen unter Naturschutz – ein weltweiter Spitzenwert. Laut WWF unterstreicht die aktuelle Entdeckung, dass selbst in entlegenen Regionen noch intakte Lebensräume existieren, die für viele Arten überlebenswichtig sind.
Hoffnung für den Himalaya und darüber hinaus
Schneeleoparden gelten als Indikatorart für stabile Gebirgsökosysteme – wo sie leben, funktioniert die Natur. Der eDNA-Nachweis in Bhutan beweist, dass diese Lebensräume noch immer Rückzugsorte für seltene Wildtiere bieten. Doch ihr Überleben hängt davon ab, ob es gelingt, Naturschutz und menschliche Nutzung langfristig in Einklang zu bringen.
World Wildlife Fund (WWF) – Pressemitteilung: „eDNA reveals snow leopard presence in Bhutan’s mountain rivers“, veröffentlicht am 20. Oktober 2025
🔗 https://www.worldwildlife.org/news/stories/edna-reveals-snow-leopard-presence-in-bhutans-mountain-rivers
Weitere Beiträge
Steinbock
Der Alpensteinbock (Capra ibex) lebt in den steilen Bergregionen der Alpen und ist perfekt an das raue Gebirgsklima angepasst. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Gräsern und Kräutern, und er findet Schutz in hohen Felswänden. Durch Schutzmaßnahmen sind die Bestände heute stabil, obwohl der Steinbock einst fast ausgerottet war.
Murmeltier
Das Murmeltier ist ein meisterhafter Gräber und lebt in unterirdischen Bauten, die es vor Kälte und Raubtieren schützen. Im Sommer frisst es sich eine dicke Fettschicht an, um den langen Winterschlaf zu überstehen. Murmeltiere leben in Familiengruppen und warnen sich gegenseitig mit schrillen Pfiffen vor Gefahren – eine eindrucksvolle Anpassung an das Leben in freier Wildbahn.
Eisbär
Der Eisbär (Ursus maritimus) ist das größte an Land lebende Raubtier und lebt in Europas nördlichen Polarregionen, insbesondere auf Spitzbergen. Diese beeindruckenden Einzelgänger verbringen viel Zeit auf dem Meereis, wo sie hauptsächlich Robben jagen und sich hervorragend an die eisigen Temperaturen angepasst haben. Doch die Bedrohung durch den Klimawandel und das Schmelzen des arktischen Eises gefährdet zunehmend ihren Lebensraum.
Rentier
Das Rentier, wissenschaftlich Rangifer tarandus, ist ein an die Kälte angepasstes Säugetier, das in großen Herden durch die Tundra und die borealen Wälder der Nordhalbkugel zieht. Mit einer Schulterhöhe von bis zu 150 cm und einem breiten Nahrungsspektrum ist das Rentier optimal auf das raue Klima seiner Heimat eingestellt.
Wildschwein
Das Wildschwein ist der gemütliche Waldbewohner. Die Urform unserer Hausweine kann weit laufen und schwimmen. Wenn es im Wald nach Maggi riecht, sind oder waren Wildschweine in der Nähe.
Marderhund
Der Marderhund sieht dem Waschbären zwar sehr ähnlich, ist aber nicht mit ihm verwandt. In Japan gilt er als Fabeltier. Er kam zu uns durch Pelztierfarmen und durch das aussetzten für die Jagd nach Europa.
Reh
Das Reh ist in Europa die kleinste und auch am häufigsten vorkommende Hirschart. Wildbrücke zeigt dir noch mehr spanende Fakten rund ums Reh.
Luchs
Er ist nach dem Bär und dem Wolf der drittgrößte Beutegreifer Europas. Wildbrücke zeigt dir noch mehr spannende Fakten zum Luchs.
Maulwurf
Der Europäische Maulwurf (Talpa europaea) ist ein faszinierender Tunnelbauer, der unter der Erde ein verborgenes Reich erschafft. Mit seinen kräftigen Pfoten gräbt er weite Gänge, um Würmer und Insekten zu jagen. Entdecke, warum Maulwürfe trotz ihrer Hügel im Garten nützliche Helfer für das Ökosystem sind und welche erstaunlichen Fähigkeiten sie besitzen!
Dachs
Dachse bringen ihre Nahrung nicht mit in den Bau und ihren Toilettengang verrichten sie in Gemeinschaftstoiletten weit weg vom Bau.